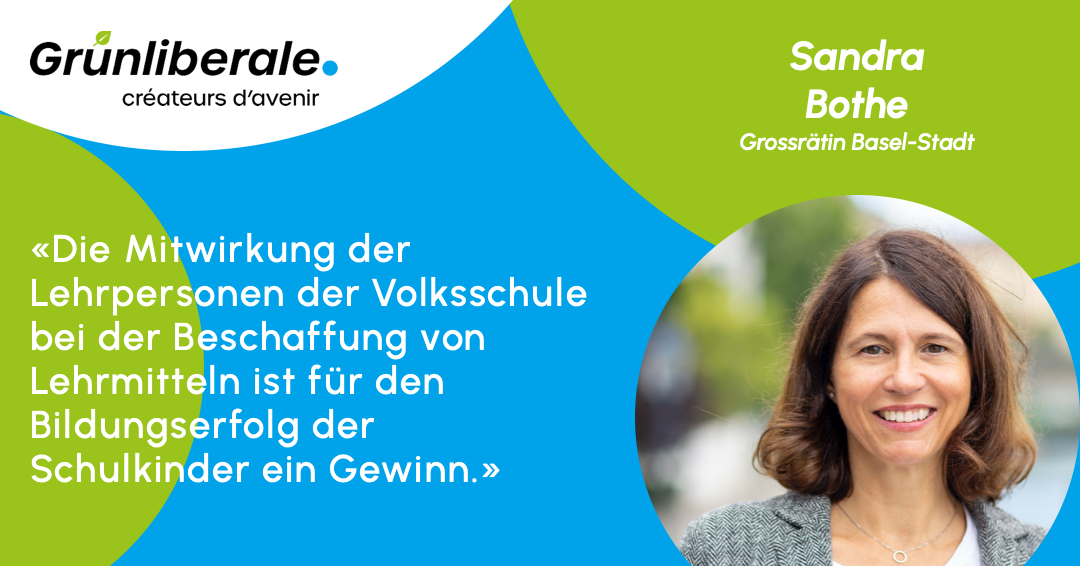Grosser Rat 15. Dezember 2022: Notiz zum Anzug hürdenfreier, flexibler Eintritt in den Kindergarten
Mit dem Beitritt zum HarmoS-Konkordat wurde der Stichtag für den Eintritt in den Kindergarten auf den 31. Juli gelegt. Der Umstand hat dazu geführt, dass eintretende Kindergartenkinder nun durchschnittlich 3 Monate jünger sind als früher. Dies bereitet den Eltern Sorgen und führt zu einer höheren Belastung für die Kindergartenlehrpersonen.
Der frühe Schullaufbahneintritt kann bei Kindern zu Problemen führen, die alters- und entwicklungsbedingt für den Kindergarten noch nicht reif sind. Die Problematik bleibt beim Übertritt in die 1. Klasse der Primarschule oft bestehen und kann sich sogar später bis zu einem allfälligen Übertritt in die Berufslehre fortsetzen.
Die Schwierigkeit wurde vom Erziehungsdepartement Basel-Stadt erkannt und in der Folge ein erleichtertes niederschwelliges Rückstellungsverfahren eingeführt. Dies ist zu begrüssen, weil eine Flexibilisierung des Kindergarteneintritts ganz ohne Hürden unerwünschte Nebeneffekte hätte. Bildungsökonomische Studien belegen, dass der Anteil später eingeschulter Kinder grösser ist, je mehr Mitsprache die Eltern erhalten. Das liegt daran, dass Erziehungsberechtigte den Alterseffekt kennen. Das heisst, sie wissen, dass der Bildungserfolg später eingeschulter Kinder höher liegt. Je höher der Anteil später eingeschulter Kinder aber wird, desto mehr leidet die Chancengerechtigkeit, weil die jüngeren Kinder mit zunehmend älteren Kindern in der gleichen Klasse verglichen werden. Der Altersunterschied in einer Klasse beträgt dadurch bis zu zwei Jahre. Das benachteiligt die jüngeren Kinder. Sie werden als schwächer wahrgenommen und kommen unter Druck.
Die Wahrung der Chancengerechtigkeit ist ein zentrales Anliegen der Volksschule. Deshalb sollten Faktoren, welche diese beeinträchtigen, minimiert werden. Die Entscheidung den Kindergarteneintritt den Eltern allein zu überlassen, würde den Effekt aber verstärken.
Die GLP Fachgruppe Bildung unterstützt den vom Erziehungsdepartement vorgegebenen Prozess, dass bei einem Antrag auf Rückstellung weiterhin Fachpersonen beigezogen werden und die Entscheidung letztlich bei der Volksschulleitung bzw. bei der Leitung der Gemeindeschule liegt.
Gleichzeitig anerkennen wir die Probleme, die durch die Verlegung des Stichtags entstanden sind. Der Entwicklungsstand der Kinder ist zentral beim Eintritt in die Schullaufbahn. Der Lösungsansatz liegt aber unserer Meinung nach darin, dass der Stichtag für alle Kinder wie früher wieder auf den bewährten 30. April gelegt wird. Folglich sollten eher Möglichkeiten geprüft werden, wie im Kanton Basel-Stadt der Stichtag trotz HarmoS-Vereinbarung verschoben werden kann, anstatt den Fokus auf einen flexiblen Kindergarteneintritt zu legen.
Dies wäre ein einfaches Vorgehen, das vielen Kindern bei welchen heute eine Rückstellung in Betracht gezogen wird, entgegenkommen würde, ohne dass dadurch die Chancengerechtigkeit beeinflusst wird. Denn nach wie vor steht nach Eintritt in die Schullaufbahn mit dem Überspringen eines Schuljahres, ein geeignetes Instrument für sehr reife Kinder zur Verfügung, dass den Entwicklungsstand der Kinder individuell berücksichtig und abholt.
Letztlich ist es für den Bildungsverlauf aller Kinder von zentraler Bedeutung, dass der Eintritt in die Schullaufbahn – also in den Kindergarten – optimal gelingt. Und hier besteht durchaus Verbesserungsbedarf.
Sandra Bothe-Wenk
Grossrätin Grünliberale Basel-Stadt
Wahlkreis Riehen
Dokumente Grosser Rat zum Geschäft: https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200109945